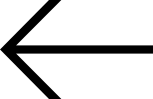Frauen in der Politik
Die politische Mitsprache blieb Schweizer Frauen lange verwehrt – viel länger als in den meisten anderen Ländern. Das wollten Frauen ändern: 1929 beteiligten sich beispielsweise auch St. Galler Organisationen an einer gesamtschweizerischen Frauenstimmrechtspetition. An der ersten nationalen Abstimmung 1959 lehnten die Stimmbürger das Frauenstimmrecht jedoch klar ab: In St. Gallen mit 80% Nein-Stimmen, in Appenzell Ausserrhoden mit 85%, in Innerrhoden mit 95% Nein-Stimmen.
Europäische Menschenrechtskonvention mit Vorbehalt
Für die zweite nationale Abstimmung über das Frauenstimmrecht mobilisierten im Vorfeld Aktivistinnen der Alten wie auch der Neuen Frauenbewegung. Die Mobilisierung erhielt durch die Diskussion über die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) Schub. Der Bundesrat wollte der EMRK nur unter Vorbehalten beitreten, da das fehlende Frauenstimmrecht in Konflikt mit der EMRK stand. Bei der nationalen Abstimmung von 1971 wurde das Frauenstimm- und -wahlrecht angenommen. Die Männer der Ostschweizer Kantone stimmten jedoch auch bei dieser Abstimmung mehrheitlich gegen die politische Gleichberechtigung der Frauen.
Bei den ersten eidgenössischen Wahlen nach Annahme des Frauenstimmrechts 1971 wurde eine Frau in den Ständerat gewählt und elf Frauen in den Nationalrat, darunter die St. Galler CVP-Politikerin Hanny Thalmann und die SP-Politikerin Hanna Sahlfeld-Singer. Die Vertretung der Frauen in politischen Institutionen stieg über die Jahrzehnte an, wenn auch nur langsam: 2024 bewegt sich der Prozentsatz von Frauen zwischen 30 und 40 Prozent.
Eine Amtsperiode – vier Politikerinnen
Auf Gemeinde-Ebene setzte sich in St. Gallen die Politische Frauengruppe (PFG) für eine grössere Vertretung von Frauen ein. Die 1980 aus dem Umfeld der Neuen Frauenbewegung gegründete PFG war ein Jahr später bereits im St. Galler Gemeinderat (heute: Stadtparlament) mit einem Parlamentssitz vertreten. Um möglichst vielen Frauen eine Plattform zur politischen Teilhabe zu ermöglichen, wendete sie ein unkonventionelles Rotationsprinzip an: Eine Frau blieb nur eines der vier Jahre einer Amtsperiode im Amt, dann rückte die nächste auf der Ersatzliste nach.
Für die politische Mitsprache bis vors Bundesgericht
Schwieriger gestaltete sich die politische Mitsprache der Appenzeller Frauen. Die Kantone entschieden nach der Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts auf nationaler Ebene nämlich individuell über dessen Einführung auf kantonaler Ebene. 1983 hatten die Frauen in allen Kantonen das kantonale Stimm- und Wahlrecht – ausser in den Halbkantonen Appenzell Inner- und Ausserrhoden.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden lehnten die Männer die Forderung der Frauen nach dem Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene bis zur Annahme 1989 viermal ab. Die Innerrhoder Männer stimmten nie zu. Erst aufgrund eines Verfahrens vor Bundesgericht, das die St. Galler Anwältin Hannelore Fuchs führte, zwang das Bundesgericht den Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 zur Einführung des kantonalen Frauenstimm- und -wahlrechts.
«Wenn Frau will, steht alles still»
Nach der formal erreichten politischen Gleichstellung blieben die Forderungen nach Gleichstellung in anderen Bereichen bestehen. Denn nicht nur die Gesetze müssen sich ändern, sondern auch die gesellschaftlich verankerten Rollenbilder. Der 1981 in die Bundesverfassung eingefügte Gleichstellungsartikel diente fortan als Referenzpunkt für Massnahmen zur Umsetzung der Gleichstellung sowie Anpassungen des Rechts.
Die dennoch weiterhin bestehenden Ungleichheiten in Wirtschaft, Politik und Care-Arbeit führten am 14. Juni 1991 – zehn Jahre nach der Einführung des Gleichstellungsartikels – zum ersten grossen nationalen Frauenstreik unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still». 2019 gingen unter dem Motto «Lohn. Zeit. Respekt» noch mehr Menschen auf die Strasse, denn die Gleichstellung ist auch heute noch nicht erreicht. In diesem Zusammenhang haben sich in vielen Städten und Gemeinden lokale Streikkomitees gebildet, die teils weiterhin aktiv sind.
Bibliografie:
- Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz (Hg.): Frauensache. Das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz, Baden 2010.
- Bräuniger, Renate (Hg.): FrauenLeben Appenzell. Beiträge zur Geschichte der Frauen im Appenzellerland, 19. und 20. Jahrhundert, Herisau 1999.
- Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF (Hg.): Frauen Macht Geschichte. Zur Geschichte der Gleichstellung in der Schweiz 1948 – 2000, Bern 2001.
- Joris, Elisabeth/Witzig, Heidi (Hg.): Frauengeschichte(n). Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz, Zürich 2016.
- Tanner, Jakob: Geschichte der Schweiz im 21. Jahrhundert, München 2015.
Biografien
Hanna Sahlfeld-Singer
Hanna Sahlfeld-Singer wuchs in Flawil auf (Jahrgang 1943), studierte in Zürich, Basel und Wien Theologie. Ab 1969 hatte sie eine Teilzeitstelle für pfarramtliche Tätigkeiten in der Gemeinde Altstätten inne. In ihrer 1.-August-Rede 1970 in Altstätten thematisierte sie das Frauenstimmrecht. Von 1971 bis 1975 war sie Nationalrätin für die SP. Mit 28 Jahren war sie die jüngste der zwölf Parlamentarierinnen der ersten Generation und die erste SP-Nationalrätin des Kantons St. Gallen. Während dieser Zeit musste sie auf ihre pfarramtliche Tätigkeit verzichten. Trotz erfolgreicher Wiederwahl entschied sie sich gegen eine zweite Amtsperiode. Mit ihrer Familie zog Sahlfeld-Singer ins Rheinland, wo sie als Schulpastorin für evangelische Religionslehre arbeitete. Ausserdem engagierte sie sich in der Partnerschaftsarbeit mit Kirchen in Indonesien sowie mit der Gründung eines Weltladens 1981 für den Fairen Handel.
Lucrezia Meier-Schatz
Lucrezia Meier-Schatz wurde 1952 in Le Locle geboren. In Neuchâtel studierte sie Politikwissenschaft und arbeitete für sieben Jahre als Leiterin der Abteilung «Politische Studien» bei der CVP. An der Universität Berkeley forschte sie zu Menschenrechtsthematiken und schrieb ihre Dissertation zum Thema christliche Soziallehre. Nach ihrem Umzug nach St. Gallen war sie Geschäftsführerin des Dachverbands Pro Familia Schweiz. Sie war Präsidentin der CVP des Kantons St. Gallen sowie Mitglied des Parteipräsidiums der CVP Schweiz. 1999 wurde sie für die St. Galler CVP in den Nationalrat gewählt, in dem sie 16 Jahre vertreten war. Von Beginn an war sie Mitglied der Wirtschaftskommission, ab der zweiten Legislatur zusätzlich in der Geschäftsprüfungskommission. Eines ihrer Hauptthemen war die Familienpolitik. Neben der politischen Tätigkeit engagierte sich Meier-Schatz in verschiedenen Vereinen, Institutionen und Stiftungen und publizierte zu wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen.