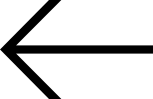Migrationsgeschichte
Die Migration in die Schweiz war nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem vom Wirtschaftswachstum und dem Kalten Krieg geprägt. Da die Schweiz im Kalten Krieg auf der Seite der Westmächte stand, nahm sie Flüchtlinge aus dem Einflussbereich des Kommunismus auf. Diese wurden grundsätzlich positiv aufgenommen: So 1956 nach dem Ungarn-Aufstand und 1968 nach dem Prager Frühling. Dies lag unter anderem am Anti-Kommunismus, aber auch an der Wirtschaftssituation.
Saisonniers
Bis Mitte 1970er-Jahre herrschte nämlich wirtschaftliche Hochkonjunktur. Dies führte in der Schweiz zu einer Nachfrage nach Arbeitskräften, die sie mit dem Anwerben von Arbeitskräften aus dem angrenzenden Ausland zu decken versuchte, in St. Gallen vor allem aus Italien. Ab den 1960er-Jahren migrierten auch vermehrt Menschen aus dem damaligen Jugoslawien nach St. Gallen. Basierend auf dem 1931 eingeführten Saisonnier-Statut führte die Schweiz ein Rotationsprinzip ein, wonach Arbeiter*innen jeweils nur neun Monate in der Schweiz bleiben durften, danach wieder ausreisen und erneut eine Arbeitsbewilligung beantragen mussten. Sie durften auch ihre Familie nicht mitnehmen und waren rechtlich nicht abgesichert. Mit diesem Rotationsprinzip wollte die Schweiz von der Arbeitskraft der Arbeitsmigrant*innen profitieren, sie aber an einer langfristigen Niederlassung und Einbürgerung hindern.
«Überfremdung»
In diesen Jahren hatte nicht nur die Wirtschaft Hochkonjunktur, sondern auch sogenannte Überfremdungsängste. Die Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat (NA) stellte die Einwanderung als Gefahr dar. Mit James Schwarzenbach hatte die NA 1967 ihren ersten Sitz im Nationalrat. Initiativen wie 1970 die «Schwarzenbach-Initiative» zielten darauf ab, die Immigration einzudämmen. Ab den 1980er-Jahren wurde Asyl zum Thema von aufgeheizten politischen Debatten.
Migrantische Selbstorganisation
Unter anderem wegen den Überfremdungsängsten erlebten Migrant*innen Vorurteile und Diskriminierung. Aus dieser Situation entwickelten sie Strategien und Praktiken, um trotz fehlender politischer Mitsprache die Schweizer Politik und Gesellschaft zu beeinflussen. Migrantische Vereinigungen, meist entlang nationaler Zugehörigkeiten organisiert, bauten Unterstützungsstrukturen auf und vernetzten sich beispielsweise mit Gewerkschaften oder Teilen der Neuen Frauenbewegung.
Im Kontext der Schwarzenbach-Initiative formierte sich Widerstand. Migrantische Organisationen, Teile der Gewerkschaften, christliche Organisationen und radikale Linke schlossen sich zu einem zivilgesellschaftlichen Bündnis zusammen. 1977 reichten sie die «Mitenand»-Initiative ein. Diese forderte die Abschaffung des Saisonnier-Statuts, Rechtsgleichheit und eine Verpflichtung des Staates zur Integration der ausländischen Bevölkerung. Die Initiative wurde zwar abgelehnt, führte aber zu einer weiterführenden Vernetzung.
Bibliografie:
- Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen (Hg.): Eine Geschichte der St. Galler Gegenwart – Sozialhistorische Einblicke ins 19. und 20. Jahrhundert, St. Gallen 2019.
- Holenstein, André/Kury, Patricia/Schulz, Kristina: Schweizer Migrationsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2018.
- Lüthi, Barbara/Skenderovic, Damir (Hg.): Switzerland and Migration. Historical and Current Perspectives on a Changing Landscape, Cham 2019.
- Pineiro, Esteban u.a. (Hg): Soziale Arbeit und Integrationspolitik in der Schweiz. Professionelle Positionsbestimmungen, Zürich/Genf 2023.
- Tanner, Jakob: Geschichte der Schweiz im 21. Jahrhundert, München 2015.
Biografien
Anonym
Die Zeitzeugin ist 1972 im ländlichen Serbien im damaligen Jugoslawien geboren. In wirtschaftlich und familiär schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, wurde ihr die gewünschte Ausbildung vorenthalten. Als Kinderbetreuerin einer Familie, die selbst in der Schweiz tätig waren, kam sie Ende der 80er Jahre in die Schweiz. Sie arbeitete als Saisonnierkraft in der Gastronomie und Hotellerie in Graubünden, später in St. Gallen. Anfang der 90er Jahre wurde wegen des ersten Jugoslawienkriegs die vorgeschriebene 3-Monatige Rückkehr immer schwieriger. Erst mit einer B-Bewilligung war ab Mitte der 1990er Jahre der durchgehende Aufenthalt für sie und ihre Familie möglich.
Viliam Pollak
Viliam Pollak wurde 1951 in Bratislava geboren und wuchs während des kommunistischen Regimes auf. Nach der Schulzeit besuchte er die Hotelfachschule. Den Prager Frühling 1968 und den Einmarsch der Russen erlebte er mit, die Familie entschied sich aber zunächst gegen eine Flucht. Im Frühling 1969 emigrierten sie in die Schweiz. Zunächst arbeitete Viliam Pollak in einem Restaurant in Wattwil und bei Mövenpick in Lausanne. Er holte die Matura nach und absolvierte die Sekundarlehramtsschule in St. Gallen. Von 1976 bis 2013 unterrichtete er an der «Meitleflade». Ehrenamtlich war er im Pfarreirat Engelburg, im Katholischen Parlament St. Gallen und bei «Kultur in Engelburg» aktiv.
Tengyal Tayong
Tengyal Tayong (ca. 1951) wuchs in Tibet (Gyantse und Pagri) auf, bis die Familie im Jahr 1959 aufgrund der wachsenden Repression durch die chinesische Armee nach Nordindien flüchtete. Als 10-Jähriger kam er durch ein Bildungsprogramm der tibetischen Exilregierung ohne seine Eltern ins Pestalozzi-Dorf nach Trogen. Nach Abschluss seiner Lehre in der Landwirtschaft reiste er 1973 nach Südindien aus, um seine Eltern zu unterstützen, was auch dem Ziel des Entwicklungshilfeprogramms entsprach. Tengyal Tayong lernte dort seine Frau kennen. Die beiden entschieden sich nach der Geburt des ersten Kinds 1979, wieder in die Schweiz zu gehen. Die Familie mit vier Kindern lebte im Appenzeller Land und in der St. Galler Bodenseeregion, wo Tengyal Tayong verschiedenen Tätigkeiten als technischer Assistent und als Gärtner tätig war.
Fausto Tisato
Fausto Tisato wurde 1959 geboren und wuchs in St. Gallen auf. Seine Eltern waren von Italien in die Schweiz migriert. Er absolvierte eine Grafiker-Lehre und zog nach Bern. Anschliessend ging er mit seiner Partnerin nach Italien, wo er in verschiedenen kulturellen Projekten arbeitete. Mit den zwei Kindern kehrten sie in die Schweiz zurück. Heute arbeitet er als Grafiker in Heiden.